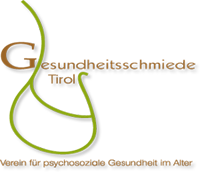
Funkenflug Erzählungen
Menschen im Alter begleiten
Frau M. ist schon eine lange Zeit im Wohnheim und kann Ihre Lage mittlerweile einigermaßen ertragen. Sie kam ins Wohnheim aufgrund der Erkrankung Ihres Mannes und mit viel Überredungskunst von der Familie und der Notwendigkeit, dass Ihr Mann nicht alleine mit dieser Erkrankung bleibt, verließ Sie sehr Ihr zu Hause. Ihr zu Hause der Haushalt und die Arbeit waren neben Ihrer Familie die zweitgrößten Werte die Sie hatte, da Sie in Ihrer Kindheit schon früh Ihre Heimat verlassen müsste. Als Kind mit 4-5 Jahren verließ die Familie Ihr geliebtes Bozen um als Südtiroler-Einwanderer in Innsbruck Fuß zu fassen. Die Familie kam aus Südtirol war aber italienisch stämmig und tat sich sehr schwer in der neuen Heimat in Innsbruck, da Sie kaum die Sprache beherrschten und mit vielen Vorurteilen zu kämpfen hatten.
So war Frau M. seit Kindheitsbeinen an entwurzelt, heimatlos und fühlt sich bis heute noch fern Ihrer. So war es für Sie umso wichtiger hier ein zu Hause einen Platz zu haben, wo Sie Heimatgefühle entwickeln konnte, um zu verstehen wie schwer es für Sie war Ihre Wohnung aufzugeben. Gleichzeitig muss man verstehen dass Frau M zu Hause im elterlichen Betrieb arbeiten gelernt hat, innerfamiliär in dieser Arbeit und in der Familie das ferne zu Hause überbrückte und dabei auch etwas Heimat fand, oder das Heimweh zu bewältigen versuchte. Sie lente auch im elterlichen Betrieb. Ihren Mann kennen und gründete mit Ihm eine Familie und doch ein sehr gutes Leben in Innsbruck führen konnte. Bis zu dem Tag an dem Frau M. Ihre Wohnung und Arbeit wieder verlassen musste. Es waren anfänglich schwierige Zeiten im Wohnheim mit sehr hoher auch psychischer Symptomatik. Es waren sehr schwierige Zeiten wie Ihr Mann durch die schwere Erkrankung verstarb. Wir im psychosozialen Dienst begleiten Frau M. wöchentlich um Ihren Verlust- und Ihre Belastungen mitzutragen.
Im Grunde Mensch sein
Ein dreidimensionales Menschenbild mit einer körperlichen, psychischen und geistigen Dimension ist in der Palliativmedizin und in der Arbeit mit älteren Menschen sehr hilfreich, um die Würde der Person zu schützen und im Umgang mit Krankheiten zu helfen. Den Menschen mit einer geistigen Person im Hintergrund zu betrachten, die Ansprache an ihn zu richten egal unter welcherkörperlichen und psychischen Erkrankung er leidet, hilft uns als BegleiterInnen und den PatientInnen den Eigen- und den Fremdwert des Menschen zu schützen, den Betroffenen im Gespräch zu erreichen und dadurch noch etwas besser zu begleiten.
In vielen Schulungen, Beratungen und Supervisionen versuchen wir dieses Menschenbild zu lehren, ebenso wie die richtigen Haltungen und den Umgang mit psychisch erkrankten Menschen. Es ist ein Anliegen von uns, besonders die Haltung und Beziehung zum Menschen zu gestalten, da dies die Grundlage jeder Pflege, Begleitung und Therapie sein soll.
Schulungen in der Begleitung von Menschen im Alter und psychisch erkrankten Menschen:
Viele unserer Schulungen bauen auf diesem dreidimensionalen Menschenbild auf, schließen die psychosozialen Grundbedürfnisse des Menschen ein und versuchen den Aufbau dieser Grundlagen
durch spezielle Sichtweisen und Fallanalysen zu vertiefen.
Wir bieten Schulungen zu Gewalt im Umgang und Begleitung von Menschen im Alter, Schulungen im Umgang mit psychisch auffallenden Menschen mit z.B. Demenz oder schwierigen
Persönlichkeitsmustern/Persönlichkeitsstörungen, als auch Schulungen im Umgang mit sich selbst oder Menschen im Team. Dabei soll die Grundhaltung zur Würde der Person im Mittelpunkt stehen.
Es sollen Tage werden in denen Gemeinschaft im Team erlebt wird, wo die Haltung zum Menschen eingeübt und auf das Wesentliche in der Begleitung zurückgekommen wird.
Die Teilnehmer/Innen schätzen vor allem den Austausch untereinander, da aus verschiedenen Bereichen Beispiele und Umgangsweisen wahrgenommen, erzählt und reflektiert und in Kleingruppen als auch im Plenum eigene Themen/Problematiken/Konflikte angesprochen werden können. Die Menschlichkeit, der Wert und die Würde der Person werden wohl die größten Leitfaktoren zur Bekämpfung der Personalnot in den sozialen Berufen werden und unmittelbar mit der Arbeitszufriedenheit zusammenhängen. In diesem Sinne machen wir uns auf den Weg zu diesem Wert und Würde der Person, im Umgang mit sich selbst, mit den Mitarbeitern/Innen und den Patienten/Innen.
Wir freuen uns, wenn wir diesen Weg gemeinsam gehen.
Trotzdem ja zur Aufgabe:
Wir die Gesundheitsschmiede Tirol, Verein für psychosoziale Gesundheit im Alter, sind mittlerweile schon seit 17 Jahren als Fachpersonal zur Unterstützung von Wohn- und Pflegeheimen tätig. Durch psychologische Therapien, Begleitungen, Supervisionen, Beratungen und Seminaren versuchen wir PatientInnen der Wohn- und Pflegeheime zu begleiten, das psychische Leid zu lindern, eine verbesserte Lebensqualität zu erarbeiten und die PflegerInnen in ihrem Umgang mit den schwierigen Verhaltensweisen und Erkrankungen zu schulen und beraten. Auf unserem Weg stoßen wir immer wieder an unsere Grenzen: können oft nur punktuell die BewohnerInnen, die Pflege und Häuser unterstützen und größere Projekte, die von den Wohn- und Pflegedienstleitungen an uns herangetragen werden kaum umsetzen.
Trotzdem jeden Tag miteinander uns dieser Aufgabe zu stellen, wird wohl der gemeinsame Weg in den Wohn- und Pflegeheimen sein. Es ist fast aussichtslos, dass Menschen mit besonderen Bedürfnissen in psychiatrischen Anstalten gepflegt werden können, weil es, wie die Zahlen zeigen, dafür einfach zu viele sind. Der Weg wird wohl dahin gehen, dass wir gemeinsam Vorort, mit adäquatem Fachpersonal, Therapien und Ausbildung des Pflegepersonals versuchen das psychische Leid der PatientInnen und BewohnerInnen und die Hilflosigkeit in der Begleitung zu verringern.
Dazu möchte ich alle Einladen Ideen an uns heranzutragen und mit uns und im Rahmen der Möglichkeiten Projekte/Ideen/… zu entwickeln und umzusetzen. Trotz all dieser Schwierigkeiten finden wir es als wunderschöne, sinnvolle und bereichernde Aufgabe diesen Weg seit 17 Jahren zu gehen und vielleicht noch weitere Schritte zu machen.
Vielen Dank und liebe Grüße
Mag. Michael Mattersberger
Die Herbsttagung
Im Vorfeld der Herbsttagung konnten wir durch Berichterstattungen in den Bezirksblättern, der Tiroler Tageszeitung und einem TV-Live Spot, das Thema der psychischen Gesundheit in Wohn- und Pflegeheimen in ein breiteres Bewusstsein heben. Auch am Tag der Tagung wurde durch den ORF- Tirol ein Interview zum Thema im Radio aufgenommen.
Die Herbsttagung selbst erfreute sich einer großen Unterstützung und Anerkennung von Vernetzungspartnern und Berufsverbänden, wo wir uns nochmal herzlich bei den Tirol Kliniken (Prim. Univ.-Prof. Dr. Josef Marksteiner ), der Koordinationsstelle Demenz (Mag.a Verena Bramböck), der Caritas (Mag.a Susanne Schlesinger), den Innsbrucker Sozialen Diensten (Dr. Reinhard Griener, Dr. Hubert Innerhofner), den Berufsverband österreichischer Psychologinnen (Mag.a Dr.in Daniela Renn), der ARGE Tirol (Obmann Robert Kaufmann), dem BFI Tirol (Dr. Michael Pardeller), dem GLE Institut Tirol (Mag.a Manuela Steger, Erika Salzmann MSc), dem TLP (Mag.a Ines Gstrein) und dem Land Tirol (Mag.a Annete Leja), bedanken.
Einige dieser Kooperationspartner unterstützten uns unter anderem mit Vorträgen bei der Tagung und somit konnten wir uns über Beiträge von Prim. Univ.-Prof. Dr. Josef Marksteiner, Dr. Reinhard Griener und Mag.a Susanne Schlesinger zur Herbsttagung freuen.
Im Eingang der Herbsttagung und nach der Begrüßung vom Obmann der Gesundheitsschmiede Tirol (Mag. Michael Mattersberger) konnte ein Überblick zur psychischen Gesundheit der Heimbewohner/innen in Wohn- und Pflegeheimen gegeben werden und auch wahrgenommen werden, dass durchschnittlich 80% der Heimbewohner/innen unter einer psychischen Erkrankung und Diagnose leiden.
In weiterer Folge konnte Bianca Plangger MSc in einer wissenschaftlichen Studie darlegen, dass Corona die Situation der psychischen Gesundheit bei den Heimbewohner/Innen natürlich nicht besser gemacht hat, sondern wie ihre Untersuchungen zeigten, signifikante Einschnitte während den ersten Isolationsmaßnahmen bei der Heimbewohner/Innen feststellte. Sie stellte fest, dass sich die Depressionswerte und auch die Ängstlichkeit bei den Heimbewohner/Innen signifikant erhöhten. Außerdem stellte sie auch fest, dass die Lebenszufriedenheit der Bewohner/Innen sich signifikant verschlechterte, ebenso ihr kognitiver Zustand. Positiv war zu erwähnen, dass nach dem Lockdown die Depressionswerte, die Ängstlichkeit und die Lebenszufriedenheit wieder auf ein Normalwert kletterten, nur die kognitiven Einschränkungen erholten sich nicht mehr.
In weiterer Folge wurde in einem Live Interview die Arbeit von Psychologen/Innen der Gesundheitsschmiede Tirol dargestellt und die psychologische Behandlung und Begleitung an einzelnen Fallbeispielen dargelegt. Wobei eine rege Diskussion zu Sexualität im Alter beziehungsweise in den Wohnheimen sich entwickelte.
Prim. Univ.-Prof. Dr. Josef Marksteiner legte in einem weiteren Vortrag zu Psychopharmaka im Alter, die vielen verschiedenen Fassetten einer adäquaten Einnahme, Verwendung und Übersicht über diesen Themenbereich dar. Er bekräftigte auch die Unterstützung und die richtige Behandlung von Psychopharmaka im Alter als Mittel zur Leidlinderung und wollte damit auch die positiven Seiten der Medikamente bekräftigen und ihren hohen Wiederstand und ihren schlechten Ruf etwas entgegensetzen.
Im zweiten Themenblock wurden die Psychohygiene und die psychischen Belastungen der Pfleger/Innen thematisiert. In einem sehr umfangreichen und detaillierten Vortrag von Dr. Griener Reinhard konnte diese Komplexität der Belastung in der Pflege gezeigt werden, manche Dinge relativiert werden und auch den hohen Wert der Arbeit beziehungsweise der Arbeitszufriedenheit gezeigt werden. Mag. Michael Mattersberger konnte im Folgevortrag seine Erfahrungen in der Unterstützung vom Pflegepersonal in Supervisionen und Seminaren darlegen und thematisierte den hohen Widerstand des Pflegepersonals zu Supervisionen, die einerseits durch Ängste und schlechte Erfahrungen gründeten und andererseits der zusätzlichen Termin eine weitere Belastung ist. Er hielt es für vorteilhaft Probesupervisionen auszumachen, um den Pfleger/Innen die Chance zu geben sich selbst ein Bild zu machen, was eine Supervision ist und wie sie ablaufen kann, in den vielen Fassetten von Fallsupervision, Themensupervision oder Teamsupervision.
Im dritten Themenblock am Nachmittag wurde hauptsächlich die Situation der Angehörigen gut besprochen und von Mag.a Schlesinger Susanne vom Caritas Servicezentrum für Demenz in Überblick gebracht. Vor allem berichtete sie auch über die schwierige Situation der Angehörigen oft im Zusammenhang mit belastenden Schuldgefühlen. In dem ersten Workshop am Nachmittag wurden Gesprächstechniken im Umgang mit Menschen mit Demenz in einer emphatischen Gesprächsführung geschult und in einem zweiten Workshop der Heimeintritt als psychosoziale Krise und die Begleitung dieser vorgetragen und diskutiert.
Im Allgemeinen war es eine sehr, sehr gelungene Veranstaltung, wo wir auch den vielen positiven Rückmeldungen dankbar sind und dankbar für die Unterstützung und Anerkennung der Gesundheitsschmiede Tirol, der Herbsttagung und dem Problembereich der psychischen Gesundheit in den Wohn- und Pflegeheimen.
Freigeist: Fortbildungszweig der Gesundheitsschmiede Tirol
- indoor Schulungen: Auf Anfrage ins Haus holen.
Cornelia auf dem Weg zurück
Cornelia ist schon lange Pflegerin in einem Wohnheim von Tirol und hat die Zeiten von Corona in den Wohnheimen sehr gut mitbekommen. Sie hat die Ängste bei den ersten Corona-Infektionen miterlebt, die ständigen Anforderungen und Überforderungen in den Wohnheimen durch getragen und stellt fest, dass diese doch längere Zeit der Beanspruchung und Überbeanspruchung auch mit ihr etwas gemacht hat. Sie erkennt, dass sie oft überreizt und müde ist, aber auch, dass ihre Ängste zugenommen haben. Cornelia beschreibt, dass sie im Grunde einen ängstlichen Charakter hat und schon in ihren früheren Lebensjahren unter Ängste und panikartige Zustände litt, die besser oder schlechter wurden. Sie erläutert genau wie sie mit dieser Angst umgegangen ist, konnte sich sehr gut unter Kontrolle halten und macht vieles richtig, so wie man es psychologisch auch empfehlen würde. Sie macht jedoch deutlich, dass sie sich durch die Überanstrengung und Überforderung grundsätzlich nicht mehr so kräftig und eher müde fühlt und dadurch wahrscheinlich der Stresslevel erhöht und die Grundstimmung belasteter ist und damit die Ängste mehr Raum bekamen.
Sie erzählt, dass sie durch die längeren Isolationsmaßnahmen zusätzlich soziale Ängste entwickelt hat. Das bedeutet, dass sie nicht mehr so gerne unter Leute geht, dass auch die Kommunikation mit den MitarbeiterInnen in letzter Zeit etwas Stressbehafteter ist und sie sich oft schon im Vorfeld unsicher fühlt und viele Gedanken macht. Sie möchte wieder diese innere Anspannung und ihre Ängste etwas reduzieren und zurückfinden in diese Normalität vor Corona, zurückfinden in ein besseres Wohlbefinden in sich selbst. Wie beschrieben, versuchten wir Lösungsvorschläge zu erarbeiten, wie sie immer wieder zu sich selbst zurückkommen kann, wo sie ihre Gedanken stoppt, Grenzen einzieht, um in der Überforderung bei sich zu bleiben und unter anderem auch versucht Entspannungsmöglichkeiten durch die Atmung einzuüben. Dieses „zurück kommen“ zu sich selbst und damit ein „zurück kommen“ in eine Welt des Miteinanders, ist ihr sehr wertvoll. Schon allein um ihre Familie zu besuchen, ihre Töchter und Enkelkinder zu begleiten, entspannt einkaufen zu gehen oder in ein gutes Miteinander in der Arbeit zu kommen. So versucht Cornelia, jetzt nach Corona, in dieses Miteinander zurück zu finden, indem sie, wenn sie sich stark fühlt, sich immer wieder mit diesen Angstsituationen konfrontiert, damit sie diese Ängste ein wenig desensibilisiert, um das was ihr wichtig ist zu leben. Die Kräfte bezieht Cornelia aus der Natur, aus den Tieren und indem sie immer wieder in die Beziehung zu Natur und den Tieren geht, fühlt sie sich kraftvoll, tankt sich auf und kann sich mit dieser Kraft immer wieder mit ihren Ängsten auseinandersetzen. Im Kontakt mit der Natur, im Kontakt mit sich selbst, findet sie auch wieder in ein Miteinander.
In dieser Beziehung zu sich selbst, den Mitmenschen, und der Natur wird wohl immer unser Weg bleiben und in ein Vertrauen zum Leben münden.
Ich glaube sie mögen mich nicht mehr ...
Herr T. ist Mitte siebzig und leidet an einer schweren neurologischen Erkrankung, die ihn schon frühzeitig in das Wohn- und Pflegeheim führte. Er ist unglücklich, dass er nicht zuhause leben kann, doch die Belastungen der Pflege kann seine Frau nicht tragen, da sie selbst schon im höheren Alter ist. So sitzt er meist allein in seinem Zimmer, in der Gemeinschaft fühlt er sich nicht besonders wohl. Er ist nicht aus Österreich, wenn auch schon vor langer Zeit aus einem Nachbarland nach Innsbruck gezogen. Die Anpassung an das Wohnheim fällt ihm schwer. Er ist grundsätzlich ein eher zurückgezogener Mensch, versucht Konflikte zu vermeiden und kann daher oft nicht sagen was er sich wünscht bzw. seine Bedürfnisse nur sehr leise äußern. All seine Traurigkeit oder auch seinen Ärger versteckt er in sich, kann kaum über seine Gefühle sprechen und richtet den Ärger oft gegen sich selbst. In dieser schwierigen Situation der Anpassung an die neue Lebenssituation entwickelte Herr T. eine depressive Verstimmung. Es drückt ihn alles nieder, sagt er. Wir begleiten Herrn T. mittlerweile schon ein halbes Jahr. Die Begleitung verlief soweit sehr gut und löste auch die emotionale Belastung im Hintergrund, sodass sich die depressive Verstimmung etwas verbesserte. In letzter Zeit war aber wieder eine erhöhte Depressivität bei Herrn T. festzustellen. Mittlerweile befanden wir uns im 3. Lockdown und die Isolationsmaßnahmen machten ihm schwer zu schaffen.
Durch die geltende 2G Regel konnte ihn seine Ehefrau, die nicht geimpft war, nicht besuchen. Herr T. wollte sich ebenfalls nicht impfen lassen und nannte mir als Grund seine Erfahrung, dass seine Schwester vor langer Zeit durch eine Impfung im 23. Lebensjahr körperlich und geistig schwer beeinträchtigt worden sei, sodass ihre Mutter sie bis an ihr Lebensende pflegen musste. Diese Erinnerungen und die Befürchtung, dass es wieder so kommen könne, beschäftigten ihn. Dies sage er aber nur mir. Er habe das den Pflegerinnen und Pflegern nicht gesagt, müsse er auch nicht, so sagt er. Er merke aber, wie die Pfleger bzw. sein Umfeld negativ auf seine Nichtbereitschaft sich impfen zu lassen, reagierten. Er glaube, dass er benachteiligt werde und die Pfleger sich in letzter Zeit anders verhalten würden. Auf Nachfrage konnte er keine konkreten Beispiele nennen. Es ist nur so ein Gefühl, das er beschreibt. In Telefonaten, die ich in dieser Zeit manchmal mit den Angehörigen führte, äußerte seine Frau genau das gleiche Gefühl. Sie berichtete mir ebenfalls von einer prägenden Erfahrung, dass ihre Brüder durch eine Impfung Schaden erlitten hätten.
Sie nehme aufgrund ihrer Verweigerung der Impfung ebenfalls einen starken Druck von außen, von der Gesellschaft wahr. Beide konnten nicht trennen zwischen dem was wirklich passierte und einem Gefühl, das allgemein in ihnen stattfand. Beide jedenfalls, der Patient selbst als auch seine Frau, waren durch die Situation sehr belastet. Es führte dazu, dass sich die depressive Stimmungslage von Herrn T. wieder verstärkte, gefühlt Sanktionen und Verletzungen stattfanden sowie großer Druck durch das Gefühl, die Gesellschaft stelle sich gegen sie.
Eine solche Situation kann nur, wie auch mit dem Patienten und mit der Angehörigen besprochen, im Dialog, nur im Miteinander gelöst werden, sodass vielleicht Möglichkeiten des Umgangs oder der Lösung mit Herrn T. selbst, seiner Frau, den Pflegerinnen und Pflegern und dem Wohnheim gefunden werden könnten – Möglichkeiten wie sich die Ehepartner sehen sowie Vorurteile und Ängste durch ein gegenseitiges Verstehen und Sprechen über die eigenen Gedanken und Gefühle abgebaut werden können. In diesem Miteinander, im Verstehen und in der Toleranz, aber auch in der gemeinsamen Problemlösung können in einzelnen Situationen wie hier, bis hin zu gesellschaftlichen und politischen Verantwortungen wieder ein Gefühl der Gemeinsamkeit und nicht des Gegeneinanders entstehen.
Anna
Fr. Anna leidet an einer Persönlichkeitsstörung, verschiedenen psychosomatischen Beschwerden und einer depressiven Erkrankung. Ihr Leben ist seit vielen Jahrzehnten durch die Schwere ihrer psychischen Diagnosen geprägt. Fr. Anna ist erst 70, lebt aber bereits seit über 15 Jahren im Pflegeheim. Sie hat kaum soziale Kontakte; vorhandene Beziehungen gestalten sich schwierig und sind meist konfliktbehaftet. Auch im Heim gab und gibt es immer wieder Schwierigkeiten und Konflikte; Fr. Anna fühlte sich oft unverstanden und zu wenig umsorgt, auf der anderen Seite aber auch durch das Leben im Heim eingeschränkt. Sie zog sich phasenweise tagelang vollkommen zurück, verblieb nur im Bett und wollte nicht mehr leben. Regelmäßige Aufenthalte in der Psychiatrie waren die Folge – einerseits zur medikamentösen Einstellung und psychischen Stabilisierung, andererseits waren sie aber auch immer wieder eine Entlastung für die Pflege, die durch Fr. Annas zum Teil sehr unkooperatives Verhalten, vor allem aufgrund eines starken Gefühls des Nicht-Könnens, sehr gefordert und manchmal überfordert war.
Die Situation war für beide Seiten belastend und so wurde eine psychosoziale Therapie angefragt und von der Gesundheitsschmiede Tirol übernommen. Es sollte versucht werden, für Fr. Anna ein stabiles, haltgebendes Gegenüber zu sein, sie in Lebensfragen, vor allem in der Aufarbeitung und Akzeptanz von Verlusten im Zusammenhang mit ihrer Erkrankung, zu begleiten, zum Erhalt ihrer Aktivitäten und Ressourcen beizutragen und so eine gewisse Stabilisierung ihres psychischen Zustands zu erreichen.
Als ich die Betreuung von Fr. Anna mit übernahm, wurde sie bereits seit mehreren Jahren durch die Gesundheitsschmiede Tirol begleitet. Ich erlebte Fr. Anna der Betreuung gegenüber grundsätzlich sehr aufgeschlossen. Es kostete sie manchmal große Überwindung Einladungen zu Spaziergängen anzunehmen und sie brauchte oft große Unterstützung, vor allem motivierende Gespräche, bei der Erledigung der morgendlichen Aufgaben. Wenn dies gelang, konnte sie aber doch Momente der Freude erleben und war anschließend deutlich positiver gestimmt und dankbar für die Begleitung. Wir sprachen in den Betreuungseinheiten viel über ihre körperlichen Beschwerden sowie Konflikte und Schwierigkeiten mit Angehörigen, einzelnen Pflegekräften oder im Heimalltag und versuchten Lösungen zu erarbeiten.
Insgesamt baute sich ein vertrauensvolles Verhältnis auf, in dem Fr. Anna einen gewissen Halt zu finden schien. Zu gewissen Zeiten des Jahres, vor allem rund um die Weihnachtszeit kam es dennoch immer wieder zu Einbrüchen der erreichten psychischen Stabilisierung und auch Aufenthalte in der Psychiatrie konnten nicht gänzlich vermieden werden. Fr. Anna wurde auch während ihrer Klinikaufenthalte zumeist weiter betreut und so die positive therapeutische Beziehung aufrechterhalten. Es wurde erreicht, dass die Abstände zwischen den Aufenthalten in der Psychiatrie beträchtlich ausgeweitet oder eine Einweisung zum Teil sogar gänzlich vermieden werden konnten.
Fr. Anna wird nach wie vor zweimal wöchentlich von der Gesundheitsschmiede Tirol betreut und begleitet. Auch wenn ich mittlerweile nicht mehr in die ständige Betreuung eingebunden bin, übernehme ich dennoch immer wieder gerne in größeren Abständen anfallende Vertretungen und freue mich dann immer, Fr. Anna wieder zu sehen. Nach wie vor gibt es gute und schlechtere Phasen, in Anbetracht der Schwere ihrer psychischen Erkrankungen sind die langjährige Begleitung, die stabilen und tragfähigen therapeutischen Beziehungen, die Verbesserung der Situation am Stock (durch das ständige Bemühen ein besseres Verständnis der psychischen Erkrankung zu erreichen) sowie die deutlich seltener gewordenen Einweisungen in die Psychiatrie aber sehr positiv zu bewerten. Nach wie vor wird die Unterstützung durch beratende und klärende Gespräche durch die Angehörigen in größeren, aber regelmäßigen Abständen angenommen und auch mit der Pflege besteht ein ständiger Austausch im Bemühen darum, Fr. Anna in ihrem Rahmen so viel Lebensqualität wie möglich zu erhalten.
Gertraud im Corona-Jahr
Ich betreue Gertraud noch nicht so lange. Sie ist gerade erst einen Monat vor Ausbruch der Corona Pandemie ins Wohnheim gezogen. Zuhause war sie alleine. Nach dem Tod ihres Mannes war sie einsam und konnte sich mit ihren mittlerweile über neunzig Lebensjahren nicht mehr selbst versorgen. Sie war glücklich ins Wohnheim zu kommen, weil auch eine Freundin von ihr dort lebte. So konnten sie sich treffen, gingen gemeinsame Spazierrunden durch den Park, saßen gemeinsam mit ihren Angehörigen im Café und insgesamt schien es für sie ein guter Schritt gewesen zu sein. Ich begleitete sie durch diesen Prozess der Eingewöhnung ins Wohnheim, unterstützte sie durch Gespräche in ihren psychosozialen Bedürfnissen und es schien mir, dass sie sich recht gut an die neue Lebenssituation anpasste. In der ersten Lockdown Phase nahm sie es sehr geduldig hin, dass ihre Angehörigen nicht mehr kommen konnten; telefonierte stattdessen viel mit ihnen. Je länger diese Schutzmaßnahmen allerdings dauerten, umso belastender wurde die Situation für Gertraud.
Sie ärgerte sich, dass sie kaum noch auf ein anderes Stockwerk gehen konnte um ihre Freundin zu besuchen und nicht hinausgehen sollte und fiel langsam in eine depressive Verstimmung. Die depressive Stimmungslage, der Ärger, die Aggression und die daraus resultierende emotionale Belastung hatten auch Einfluss auf ihre kognitive Leistungsfähigkeit. Es folgten Verwirrtheitszustände, in denen Gertraud nicht mehr klar war und sie den Kontext der Lage kaum noch erfassen konnte. So kippte ihr Ärger über die Situation in eine Angst vor Corona. Sie konnte nur mehr die Angespanntheit der Lage erfassen, dass etwas Gefährliches in der Luft lag und sie aufpassen musste. Gertraud fing an sich in ihrem Zimmer einzusperren, kam nicht einmal mehr zum Essen heraus und hatte Angst vor jedem Kontakt. Häufiges Hände waschen und generell die Bedachtheit auf Sicherheit waren für sie vordringlich geworden. Es dauerte einige Zeit bis sich das Vertrauen von Gertraud wieder so weit entwickelte, dass ich sie besuchen, Gespräche mit ihr führen und versuchen konnte, diese emotionale Belastung sowie die kognitive Verwirrung wieder etwas in Ruhe zu bringen und wir langsam wieder kleine Schritte aus dem Zimmer machen konnten. Wir riskierten, uns im Erdgeschoß des Wohnheims mit der Freundin zu treffen und in der Distanz jede Woche eine kleine Gesprächsrunde zu machen. So fand Gertraud langsam wieder in einen Rhythmus und einen Aktionsradius hinein, in denen sie etwas Lebendigkeit erfahren konnte. Gertraud leidet immer noch sehr unter den Schutzmaßnahmen und denkt an manchen Tagen, dass sie lieber sterben würde als so weiterzuleben, während sie an manchen Tagen die Gemeinschaft mit ihrer Freundin oder auch mit Mitbewohnern am Stock noch gut leben kann. Unsere Gespräche sind ihr sehr wertvoll um in einen Austausch zu kommen, ihr Inneres zu betrachten und so ihre Gedanken und Gefühle zu ordnen. Ich hoffe und wünsche Gertraud, dass sie doch noch einige Zeit in der Lebendigkeit in geringeren Schutzmaßnahmen leben kann. Und trotzdem wurde mir bewusst in welchem Kontext Sicherheit und Schutzmaßnahmen gelebt wurden um nicht lebensfeindlich zu werden.
Unser Leben ist die Geschichte unserer Begegnungen. (Anton Kner)
Frau R. kam nach einem Schlaganfall und anschließendem langen Krankenhaus- und Reha-Aufenthalt direkt ins Wohnheim. Sie vermisste ihre Wohnung sehr, die von ihren Kindern aufgelöst wurde. Auch das körperliche Nachlassen und die Kraftlosigkeit nach dem Schlaganfall, das Angewiesensein auf fremde Hilfe, sowie ein allgemein von viel harter Arbeit, Missbrauchserlebnissen und Enttäuschungen geprägtes Leben ließen Frau R. keinen Sinn mehr im Leben sehen. Sie zog sich in ihr Zimmer zurück, mochte zu anderen Heimbewohnern keinen Kontakt aufbauen und nahm an keinen Gruppenaktivitäten im Wohnheim teil. Sie sagte, dass sie nicht mehr leben mag und dass nach dem Schlaganfall besser Schluss hätte sein sollen. Auf Anregung der Pflege zeigte sie sich einer psychosozialen Begleitung gegenüber nicht abgeneigt. Der Beginn der psychosozialen Therapie verlief schleppend. In den ersten Gesprächen war vor allem ihr Sterbewunsch und das Erleben von Sinnlosigkeit im Vordergrund, sie konnte nichts benennen, was ihren Alltag zumindest noch ein klein wenig erhellen würde. Frau R. zeigte ein grundlegendes Misstrauen, war sehr kryptisch beim Erzählen ihrer Lebensgeschichte und erklärte das damit, dass sie schon oft von Menschen enttäuscht wurde, wenn sie sich ihnen geöffnet hatte. Nach wenigen Einheiten mit Ausflügen in die naheliegende Natur, Genussförderung und einer Fußmassage konnte sie zunehmend Vertrauen aufbauen, auch schwere Themen ansprechen und in der bedingungslosen Annahme und dem entgegenbrachten Verständnis etwas Erleichterung von ihrer Lebenslast finden. Wir förderten gemeinsam immer mehr Ressourcen und verbliebene Lebensmöglichkeiten zutage. Schließlich nahm Frau R. auch an Gruppenaktivitäten im Wohnheim teil, suchte von sich aus Gespräch und Kontakt zu anderen Heimbewohnern und erfreute sich daran – und war selbst am meisten davon überrascht, dass sie zum ersten Mal seit langer Zeit ungezwungen auf andere Menschen zugehen konnte und die Begegnungen genoss. Auf unsere wöchentlichen Termine freute sie sich schon sehr und bestand darauf, dass wir uns beim Vornamen nannten. In unregelmäßigen Abständen entwickelte sie paranoide Gedanken, fürchtete Verschwörung gegen Leib und Leben und wurde in diesen Phasen auch handgreiflich gegenüber Pflegepersonen. Unsere Beziehung war schon so tragfähig, dass sie mir in so einer akuten Phase vertraute und sich von mir lenken und beruhigen ließ.
Die psychosoziale Betreuung hatte sich gut eingespielt, und da die Gesundheitsschmiede Ausbildungsstelle für Klinische PsychologInnen ist, übernahm schließlich eine Kollegin in Ausbildung. Frau R. konnte sie anfangs gut annehmen, sich auch meiner Kollegin gegenüber öffnen. Nach ein paar Wochen wurde die Betreuung allerdings schwieriger, Frau R. stellte sich manchmal schlafend und meinte dann zu meiner Kollegin, dass sie gar nicht mehr kommen brauche und holte auch mit dem Fuß nach ihr aus. Ich übernahm die Betreuung wieder und es wurde offensichtlich, dass ich die Stärke unserer Beziehung und ihre Bedeutung für Frau R. unterschätzt hatte.
Eine Beziehung – auch wenn sie im professionellen Kontext entsteht – kann „lebenssteigernd“ sein, neue Lebenskraft und neuen Lebensmut bringen. Auch das Lächeln eines Pflegers im Wohnheim beim morgendlichen Wecken, die kurze Berührung am Arm und ein nettes Wort im Vorbeigehen von einer Pflegerin kann für Heimbewohner den Tag erhellen und den Unterschied ausmachen, zwischen Nicht-mehr-Leben-wollen und sich geborgen und gesehen fühlen. Vor dem Hintergrund der aktuellen Corona-Pandemie zeigte sich auch, wie besonders lebenswichtig und lebenserhaltend im wahrsten Sinne – unter Einhaltung der Schutzmaßnahmen – Besuche von Partnern, Kindern und Enkelkindern sind. Ein Wegfallen dieser zwischenmenschlichen Kontakte beeinträchtigt Körper, Geist und Seele – manchmal vielleicht nachhaltiger als das Virus.
Verfasst von Mag.a Daniela Siegele
Wenn die Zeit still steht, erzählt von Bettina Fraisl
Alma ist verhältnismäßig jung, in ihren 40ern, und sie lebt bereits seit einigen Jahren in einem Wohnheim, da sie aufgrund einer Krankheit, deren Ursache niemand wirklich erklären kann, geistig, körperlich, manchmal auch emotional stark beeinträchtigt ist. Alma kann nicht mehr gehen, sie liegt tagaus tagein in ihrem Bett und freut sich darüber, wenn ich zu ihr komme, wenngleich ihr Gedächtnis ein bewusstes Wiedererkennen kaum erlaubt.
Am liebsten spielt und redet sie, in einer Sprache, die nicht leicht zu verstehen ist. Alma hat viel zu erzählen, von ihrer schweren Kindheit mit vielen Schlägen, einer frühen Schwangerschaft, die sie allein bewältigen musste, von ihrer Arbeit und ihrem Kind, das woanders aufwuchs und das sie seit langem nicht gesehen hat und vermisst. Eines Tages frage ich Alma nach dem Vater des Kindes, und sie erzählt von seinen tiefblauen Augen. Ein verliebtes Lächeln zeigt sich auf ihrem Gesicht, wenn sie von ihm erzählt, obwohl er sie verlassen hat, als sie schwanger war, und sich nicht wieder um sie oder das gemeinsame Kind kümmerte. Nein, sagt sie, hassen könne sie ihn nicht. Ihr Kind habe die tiefblauen Augen geerbt, ein so tiefes Blau. Ich sehe dich förmlich in den Strom dieser Augen kippen, so wie du das beschreibst, antworte ich, und Alma nickt versonnen. Während sie erzählt, wie sie dann allein blieb, zuerst mit dem Kind, dann ohne Kind, und wie er eine andere Frau heiratete und andere Kinder bekam, nimmt sie wie nebenbei meine Hand und hält sie ganz fest. Als sie zu Ende erzählt hat, zieht sie mich zu sich, umarmt mich ganz fest und drückt mir einen Kuss auf die Wange. Sie sieht glücklich aus. Ich bin ganz berührt und umarme sie fest zurück. Für mich ist das einer dieser magischen Momente, in denen die Zeit still zu stehen scheint, weil ihre Vergänglichkeit in der Verbindung aufgehoben ist.
Verantwortlich leben, erzählt von Michael Mattersberger
Wie viele Menschen diese Ver-Antwortung leben ist mir erst jetzt, seit dieser Zeit bewusst. Über den Zusammenhalt im eigenen Verein durch unsere MitarbeiterInnen, aber auch Angehörige, PatientInnen und SystempartnerInnen, welche durch ihren Rückhalt die Existenz unseres Vereins, der Gesundheitsschmiede Tirol, gesichert haben. Ihnen allen möchte ich auf diesem Wege nochmals meinen herzlichen Dank ausdrücken.
So waren auch in vielen Gesprächen mit PflegerInnen der Wohnheime und mit MitarbeiterInnen unseres psychosozialen Dienstes diese Ver-Antwortung und die Krise herauszuhören. In meinem Beruf als Psychologe und Supervisor bin ich in supervisorischer Tätigkeit in vielen Pflegeheimen herumgekommen und war damit viel mit Teams im Gespräch und in Reflexion dieser besonderen Zeit. Die persönlichen Lebensgeschichten und die Einschränkungen, die viele MitarbeiterInnen der Pflege für den Schutz ihrer Pflegebedürftigen, ihrer BewohnerInnen und PatientInnen auf sich genommen haben, waren für mich sehr beeindruckend. Beeindruckend auch, wie vorbildhaft einzelne ihren Beruf und ihre Berufung in dieser Situation gelebt haben.
Im (Ab-)Grund Mensch sein, erzählt von Michael Mattersberger
Schritt für Schritt nähern wir uns dem Höhepunkt dieser Ausnahmesituation und Krise die uns weltweit bewegt. Stillstand, Tod und eine beispiellose Einschränkung der allgemeinen Freiheit zeigt uns die Grenzen unseres Daseins auf. Es ist, als würde man am Rande eines Plateaus stehen und in einen Abgrund schauen, wo der Boden noch nicht zu erkennen ist. Wohin führt das und wo hört das auf? Wie geht es weiter? Kann das Leben, das ich so mochte, wieder weitergeführt werden? Kann ich wie zuvor, meine Wege so frei gehen und gestalten, wie ich mir das vorgestellt habe? Diese grundlegenden Fragen führen uns in eine Tiefe, wo wir selten eintauchen, wo nur mehr Wesentliches zählt.
Der Himmel in mir, erzählt von Michael Mattersberger
Schon lange, seit Jahren, begleite ich Herrn Alfred im Wohnheim, der schon seit seiner Kindheit in einer Ausnahmesituation, in einer Ausgesondertheit lebt, da er vielleicht nicht die Intelligenz besitzt, wie der Durchschnitt der Bevölkerung, vielleicht nicht in seiner Emotionsregulierung so kontrolliert sein kann, wie andere Menschen und vielleicht in seiner Persönlichkeitsentwicklung sich oft, auch im späteren Alter, etwas kindlich, etwas abhängig und etwas ängstlich zeigt.
Alfred und ich sprechen sehr viel über seine Sorgen nicht geliebt zu werden, ein Außenseiter zu sein, krank zu sein und mit diesen Krankheiten und Behinderungen leben zu müssen. Er ist sehr religiös und legt seine Sorgen, Ängste und Sehnsüchte viel in die Hände Gottes, versucht mit vielen täglichen Gebeten und Bitten einen Weg durch das Leben zu finden. Alfred sehnt sich nach Gemeinschaft, kann sie aber kaum aushalten. Alfred sehnt sich danach, normal zu sein. Er freut sich über Besuche, die er nach 10 Minuten abbricht, weil er sie nicht mehr aushält, er freut sich über Anrufe, wenn er nicht vergessen wird und freut sich übermäßig über Zuwendung.
In seinem Glauben und in seiner Religiosität sucht er nach einem besseren Leben und freut sich auf ein besseres Leben im Himmel. So liest er viele Bücher über Todeserfahrungen und stellt sich immer wieder den Himmel vor. Bei jedem meiner Besuche fragt er mich, wie der Himmel ausschaue und er freut sich über die Worte unfassbar, undenkbar und übermäßig und stellt mir auch immer wieder die Frage, ob er da, im Himmel, noch krank sei, ob er da noch Außenseiter sei, oder wie die Farben im Himmel aussehen. Dabei versuchen wir auch oft im Gespräch dieses für den Verstand Unfassbare in eine „Ahnung in mir“ zu verwandeln. Obwohl wir den Himmel nicht mit unserem Verstand und unserem Denken fassen können, so gibt es eine Ahnung des Himmels, wo alles Leben entspringt.
Spiritualität in der Praxis, erzählt von Michael Mattersberger
So kann ich exemplarisch von einem der vielen Gespräche berichten, die im Alter, im Angesicht des Todes, immer wieder stattfinden. Ich war bei Frau Grete (Name geändert), einer sehr gebildeten Frau, die mir erzählte welche Verluste sie in der letzten Zeit erleben musste, dass sie Mann und Wohnung verloren hatte, gesundheitliche Einbußen aufgrund eines Schlaganfalles hinnehmen müsse und im Rollstuhl sitze, wo sie doch vor einem Jahr noch zu Hause lebte, in ihrem hohen Alterversuchte ein Studium zu beginnen und noch bei bester Gesundheit war. Sie haderte mit ihrer Lebenssituation und sagte, dass ihr Leben fast unerträglich geworden sei, dass die Belastungen aufgrund von Krankheiten und Alter so hoch seien, dass sie es kaum ertragen könne. Im Laufe des Gespräches sagte sie mir auch, dass sie es begrüßen würde, wenn sie sterben könnte. Auf diese Aussage hin musste ich als Psychologe fragen, ob sie Gedanken habe, sich das Leben zu nehmen. Frau Grete stoppte, schaute auf den Boden und sprach lange kein Wort. Ich fragte noch einmal nach, da ich schon in diesem Moment spürte, dass Frau Grete durch diese Frage besonders berührt wurde. So fragte ich sie noch einmal, ob sie schon einmal darüber nachgedacht habe, sich das Leben zu nehmen und nach einer Weile antwortete sie mir, „Ja, gerade heute Morgen, gerade heute Morgen konnte ich den Gedanken noch beiseite schieben.“ Das Gespräch nahm seinen Verlauf über die Belastungen des Alters, der Krankheit, das nicht Ertragen können und ich fragte auch weiter, was heute Morgen passiert war, dass sie sich doch nicht das Leben genommen hatte. Sie sagte „Wegen der Familie, wegen der Kinder und wegen der Freunde. Das ist das, was mich am Leben gehalten hat.“ Da spürte sie was sie am Leben hielt, doch der Zugang zu diesem Kraftvollen war erschüttert.
Das Gespräch verlief weiter über Ableben, über hohes Alter und Krankheit und im Kontext des Todes. Da Frau Grete eine sehr religiöse Frau und in einen sehr katholischen Kontext eingebunden war, kamen wir auch auf religiöse Themen zu sprechen. So sagte sie, sie sei trotz ihrer katholischen Grundhaltung doch eine Agnostikerin, man müsse ihr also schon beweisen, dass es einen Gott gibt und gleichzeitig sagte sie, natürlich gebe es keinen Beweis für Gott. Wo sie dennoch Gott spüren könne, sei die vierte Strophe der Deutschen Messe. Franz Schuberts „Heilig, heilig, heilig“, wo es heiße „Er, der nie begonnen, er der immer war, ewig ist und waltet, sein wird immer dar.“ So wie sie das sagte, war das ein besonderer Moment, der sehr berührend und strahlend war. „Der, der immer da war und ist.“ Dieses Gespräch hatte ein paar spirituelle Momente, es waren Momente, in denen die Patientin die Berührung zum Wesentlichen, die Berührung zum Leben spürte. Es war der Moment der Stille nach der Frage, ob sie Gedanken habe, sich das Leben zu nehmen. Man spürte die Betroffenheit, das Berührtsein vom Wesentlichen, von einer Lebensfrage: Will ich leben? Will ich sterben? Welche Möglichkeiten habe ich? Welchen Wert hat das Leben? Es war weiterhin zu spüren in der Antwort auf die Frage, was sie hinderte, sich das Leben zu nehmen, in ihrer Antwort nach der Beziehung und der Liebe zur Familie und zu den Freunden. Und es waren auch das Strahlen und die Berührung durch die Beschreibung von Franz Schuberts Sanctus. In vielen dieser psychologischen und psychotherapeutischen Gespräche, aber auch in Gesprächen des Alltags kann man immer wieder diese Momente des besonderen Berührtseins, der besonderen Tiefe, des besonderen Geheimnisses im eigenen Leben, im Leben des anderen und vielleicht auch im Kontext eines tieferen Geheimnisses des Lebens spüren. Vielleicht auch so wie es die Hirten beim Anblick des Kindes erkannten und spürten.
Hilflose Trauer, erzählt von Michael Mattersberger
Immer wieder erleben wir in unserem Arbeitsalltag, dass aus einer Hilflosigkeit bei helfenden Diensten, aus hilflosen Reaktionen der Patienten selbst, aus Zeitmangel oder Überforderung der Angehörigen zu Psychopharmaka gegriffen wird. Oft wird die Wirkung der Medikamente sehr wenig geprüft, sodass sie bei unzureichender oder sogar schädlicher Wirkung wieder abgesetzt werden können. So geschieht es auch bei vielen meiner psychologischen Begleitungen älterer Menschen, dass oftmals aus einer Hilflosigkeit heraus zu schnell, zu viel und über einen zu langen Zeitraum Psychopharmaka verabreicht werden.
Dies passierte bei meiner Begleitung von Frau Maria (Name geändert), die ihren Mann verlor und sich selbst in einem beginnenden dementiellen Abbau befand. Ich begleitete Frau Maria und ihren Mann Anton (Name ebenfalls geändert) schon etwa ein Jahr lang zuhause und auch in ihrem Übergang von zuhause ins Wohnheim, wo sie gemeinsam ein Zimmer beziehen konnten und sich nach einer längeren Eingewöhnungsphase recht gut eingelebt hatten. Nach einiger Zeit bekam Anton eine Lungenentzündung. Schon seit Jahren wollte er lieber sterben als leben, weil ihm das Leben zu schwer geworden war und durch die Lungenentzündung wurde er sehr schwach und verstarb schließlich.
Ich werde sterben, erzählt von Petra Obrist
Ich wurde vom Wohnheim telefonisch mit der Bitte kontaktiert Frau E., eine an Schizophrenie erkrankte Patientin, zur Sonographie zu begleiten. Frau E. zeigte sich in letzter Zeit sehr ängstlich und sowohl die Fahrt und der Transport mit der Rettung als auch die Untersuchung stellten eine beängstigende und herausfordernde Situation für sie dar. Bevor ich mit Frau E. in das Rettungsauto stieg, atmete ich ein paar Mal tief durch, ich wusste dass sie sehr sensibel auf von ihr wahrgenommene Gefühle ihres Gegenübers reagieren konnte, und ich musste mir eingestehen, dass ich ein wenig nervös war, obwohl ich sie schon lange kannte - oder vielleicht gerade deshalb? Es wäre nicht das erste Mal, dass Frau E. mir oder ihr unbekannten Menschen mit Argwohn gegenüber trat und ein paar harsche Bemerkungen von sich gab, sodass ich manchmal am liebsten im Erdboden verschwunden wäre.
Ich spürte Frau E. Angst deutlich, obwohl sie sich sehr ruhig verhielt und kein Wort sprach. Auch die Untersuchung ließ sie im Großen und Ganzen ruhig über sich ergehen. Einige Male murmelte der Arzt etwas für mich Unverständliches, dass hier und da eine Auffälligkeit zu beobachten sei. Nach Abschluss der Untersuchung war mir das Ergebnis unklar. Der Arzt verabschiedete sich höflich von uns, jedoch ohne uns nähere Informationen zu geben. Sobald er das Zimmer verlassen hatte, sagte Frau E. klar und deutlich zu mir: „Ich werde sterben.“ Im ersten Augenblick war ich einfach nur überrascht, dass sie plötzlich mit mir sprach. Dann traf mich der Satz mit voller Wucht. Ich war sehr berührt in diesem Moment echter Begegnung mit Frau E.
Geschichte einer Prägung: Ledig schwanger zu Kriegsende, erzählt von Bettina Fraisl
Traudl (Name geändert) war das jüngste von drei Kindern einer gut situierten Familie und wuchs behütet und gut umsorgt in Tirol auf. Ihr Vater, den sie für seine beruflichen Erfolge sehr bewunderte, nahm sie als einziges seiner Kinder manchmal auf Bergtouren mit – das waren wunderschöne Ausflüge für Traudl, auf denen sie sich ihrem Vater nahe fühlte, vertraut und geborgen, und die sie und ihre Liebe zu den Bergen sehr prägten. Bis ins hohe Alter zählten Spaziergänge und Wanderungen in der Natur zu den schönsten Momenten in ihrem Leben, erzählte Traudl immer wieder.
Als der 2. Weltkrieg ausbrach, war Traudl eine junge Frau, gerade erwachsen. Sie arbeitete fleißig und war in gutem Einvernehmen sowohl mit ihrem Arbeitsumfeld als auch mit ihrer Familie, die ihr sehr wichtig war. Oft betonte sie in ihren Erzählungen, dass man sich die Zeit damals heute kaum vorstellen könne. Wenn man später geboren sei, könne man nicht wissen, wie es damals war. Einmal habe eine Bombe das Haus direkt neben jenem ihrer Familie getroffen, es sei dadurch vollkommen zerstört worden. Die permanente Angst, der Schrecken ringsum, die allgemeine Orientierungslosigkeit und das Chaos hätten zu einer großen Unsicherheit geführt, zu einer Lebensweise ohne Pläne und ohne Planbarkeit.
Wortlos vertraut, erzählt von Daniela Siegele
Anton ist nach einem Schlaganfall halbseitig gelähmt, voll pflegebedürftig und kann sich nur durch Mimik, Blinzeln, Kopfwegdrehen und Handdrücken verständigen. Früher war er unter anderem Sraßenmaler und so fahren wir an einem kalten Tag durch die Gänge im Wohnheim und betrachten die neuen Bilder. Ich erzähle ihm zu den Bildern Geschichten, die in mir aufsteigen, mache scherzhafte Bemerkungen, hole ihm einzelne Bilder von der Wand, damit er mit dem Finger die Struktur erfühlen kann, und hänge eines aus Spaß verkehrt herum wieder auf.
Ins Herz geschlossen, erzählt von Michael Mattersberger
Eine besonders innige und berührende Begleitung erlebte ich mit Hermi, einer intelligenzgeminderten Frau, die schon seit längerem im Wohnheim lebte. In der ersten Zeit weinte und jammerte sie häufig und anhaltend und hatte einige psychosomatische Beschwerden, doch im Laufe der Jahre wurden das Weinen und Jammern weniger und seltener, und wir hatten wirklich schöne Zeiten. Jede Woche machten wir gemeinsam einen Ausflug, gingen etwa igendwohin Eis essen, ins Café, selbst bei Operationen war ich mit der Zeit ihr Begleiter auf der Klinik. Wir hatten eine außergewöhnlich gute Beziehung, wir hatten einander beide sehr ins Herz geschlossen, sie mich und ich sie.
Bittersüße Weihnachtszeit, erzählt von Michael Mattersberger
Bereits ein halbes Jahr begleitete ich Frau Wibmer in einer psychosozialen Therapie, die anfangs sehr herausfordernd war. Frau Wibmer litt nämlich unter einer paranoiden Schizophrenie, die zur Folge hatte, dass sie Menschen gegenüber sehr misstrauisch war und ein Beziehungsaufbau sich daher sehr schwierig gestaltete. Nach zwei, drei Monaten ließ mich Frau Wibmer schließlich länger als eine halbe Stunde bei ihr sitzen, erzählte mir von ihrem Alltag und vertraute mir immer mehr von ihrer Lebensgeschichte an. Stets kam ich an einem Dienstag Nachmittag zu ihr, und wir pflegten mittlerweile ein kleines Ritual, das darin bestand, dass wir zu Beginn miteinander Kaffee tranken und manchmal am Ende der Gespräche eine Platte von Elvis Presley auflegten. Ein paar Monate vergingen, zunehmend entwickelte sich eine sehr gute Beziehung zwischen uns und unsere Gespräche gewannen für Frau Wibmer an Bedeutung.
Schon kurz nach Allerheiligen kamen bei Frau Wibmer erste Weihnachtsfreuden auf. Die Aussicht auf Weihnachten schien sie zu beglücken, sie stellte einige Engel auf, und ich half mit, das Zimmer weiter zu dekorieren.
Sicherheit und Halt, erzählt von Manuela Zeidler
Vor ca. zwei Jahren lernte ich Frau C. kennen. Damals hatte sie schon mehrere stationäre psychiatrische Aufenthalte hinter sich und eine ambulante Betreuung bereits abgebrochen. Sie lebte noch zuhause, hatte jedoch aufgrund ihrer erhöhten Unruhe und ihrer häufigen Angstzustände erhebliche Probleme in der Alltagsbewältigung. Dies äußerte sich beispielsweise darin, dass sie ihre Angehörigen häufig anrief und zwanghaft Tätigkeiten kontrollierte, deren Unterlassung ihre Sicherheit gefährden könnte – das Abschließen von Türen etwa oder das Abschalten des Herdes. Außerdem machte ihr Schlafmangel zu schaffen, bis dieser medikamentös gut behandelt wurde.
Kurz nach unserem Kennenlernen durchlitt sie eine schwere Krise. Ihr Mann, der schon lange im Pflegeheim war, verstarb ziemlich plötzlich. Sie konnte sich seinen Tod nicht erklären, wo er doch noch so viel Lebenswillen gehabt hatte. Allerdings war sie froh, dass er nicht stark leiden hatte müssen.
Der Verlust ihres Mannes machte Frau C. immer wieder sehr zu schaffen. Sie war sehr froh über meine Unterstützung. Ich konnte ihr bei ihrer Orientierung helfen, indem ich ihr Zusammenhänge von Trauer und Trauerprozessen erklärte, was für sie sehr wichtig war. So konnte sie sich beruhigen und in ihrem Zustand Anzeichen von Trauerbewältigung erkennen.
Ressourcen mobiliseren und Verluste bearbeiten: Rucksäcke tragen mit Frau Amann[1], erzählt von Manuela Zeidler
Frau Amann geht es heute besser als letzte Woche. Sie beginnt nun manchmal von sich aus zu scherzen, ist aber nach wie vor immer wieder traurig. Die Last des Erlebten, insbesondere der traumatischen Erfahrungen im Zweiten Weltkrieg, und der erlittenen Verluste, allen voran des Todes ihres Mannes und des Auszugs aus dem gemeinsamen Zuhause, wiegt schwer. Zur sinnbildlichen Aufarbeitung lade ich sie zu einer Wanderung auf den Patscherkofel ein: Wir erklimmen den 2. Stock ihres Wohnheimes, und Frau Amann beschreibt, es sei sehr mühevoll hinaufzusteigen, da das Schwere, das sie erlebt habe, sie zu Boden drücke. Sie habe keine Kraft mehr, sagt sie.
„Ihr Rucksack, den Sie Ihr ganzes Leben lang mit Belastungen gefüllt haben, ist sehr schwer. Darf ich Ihnen eine Stütze sein beim Tragen?“ frage ich, an ihren Schwindel denkend, und reiche ihr meine Hand. Frau Amann lächelt dankbar und fängt mit sichtbarer Anstrengung an, Stufe um Stufe nach oben zu steigen.
[1] Der Name wurde geändert. Das Bild auf dieser Seite steht in keinerlei Zusammenhang mit diesem oder einem der folgenden Texte.
Ein denkwürdiger Silvesterabend, erzählt von Michael Mattersberger
An einem Silvesterabend freuten sich meine Frau, die am Neujahrstag Geburtstag hat, und ich darauf, nach längerer Zeit wieder einmal miteinander auszugehen. Meine Eltern waren da, um bei unseren Kindern zu bleiben, und wir waren gerade im Aufbruch, als das Telefon klingelte, und die Pflege anrief, ich solle bitte schnell kommen, es handle sich um einen Notfall, eine Patientin von mir sei ganz außer sich und randaliere dort.
Ich bat meine Frau, kurz auf mich zu warten, ich sei bestimmt gleich zurück.
Der Anblick, der sich mir im Wohnheim bot, erschreckte mich. Eine Frau mit Demenz und großem psychischen Leid, die ich seit Jahren betreute, hatte eine psychotische Episode. Schon im Gang kam sie mir mit veränderter Stimme, ungewohntem Gangbild und einer hängenden rechten Schulter entgegen und gab seltsame Laute von sich. Die PflegerInnen saßen verängstigt im Dienstzimmer und trauten sich nicht mehr heraus.
Ich ging auf die Patientin zu und nannte sie beim Vornamen. Erst gab sie mir zur Antwort, dass ich ein Hurenbock sei und verschwinden solle, doch mit der Zeit machte sich unsere wirklich gute Beziehung bemerkbar und sie ließ sich dazu bewegen, auf ihrem Platz im Essraum zu sitzen. Sie erzählte mir, welche Personen sie gerade sehe, dass ein Mann auf sie zukomme und sie misshandle, und dann rief sie wieder: „Lass mich los, schau, dass du weiterkommst, verschwind!“ Für mich war deutlich, dass sie halluzinierte, bis ich auf ihren Arm schaute, der sich tatsächlich nach außen drehte, als ob jemand daran ziehen würde. Einen Moment lang erstarrte ich und war mir selbst nicht mehr sicher, ob da nicht eine Geisterhand im Spiel sei. Doch dann betrachtete ich den Arm genauer und erkannte, dass der Oberarm gebrochen war. Die Frau war im Stiegenhaus über die Treppen gestürzt und aufgrund ihrer Schmerzen in einen psychotischen Zustand gefallen. Als mir das klar wurde, verständigten die PflegerInnen und ich sofort die Rettung und die Angehörige, welche mit in die Klinik fuhr.
Etwa gegen 22 Uhr war ich wieder zuhause, ganz mitgenommen von den Ereignissen, und viel zu erschöpft, um ans Ausgehen auch nur zu denken.